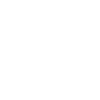Anzeichen einer Depression bei Männern erkennen
Die (unipolare) Depression gilt als eine typische Frauenkrankheit mit einer von zahlreichen epidemiologischen Studien bestätigten zwei- bis dreifach höheren Lebenszeitprävalenz bei Frauen im Vergleich zu Männern. Allerdings lässt sich die daraus abgeleitete Annahme, dass Männer ein geringeres Depressionsrisiko hätten als Frauen – sei dies biologisch oder gesellschaftlich bedingt – durchaus in Frage stellen: angesichts des Paradoxons einer im Vergleich zu Frauen dreimal höheren Suizidrate und einer gleichzeitig niedrigen Rate diagnostizierter Depressionen bei Männern kann angenommen werden, dass Männer vergleichbar häufig von Depressionen betroffen sind wie Frauen, diese jedoch seltener erkannt und behandelt werden. Letzteres wird durch Bevölkerungsstudien bestätigt.
Die Unterdiagnostizierung von Depressionen bei Männern kann auf folgende Gründe zurückgeführt werden:
- seitens der Männer auf ein mangelndes Inanspruchnahmeverhalten, die Orientierung an Normen traditioneller Maskulinität und typische Abwehrstrategien
- seitens des Medizinsystems auf eine Depressionsdiagnostik, die einen deutlichen Genderbias in Richtung „weiblicher“ Symptome aufweist, die als prototypisch gelten (orientiert an ICD-10, DSM-5), aber von Männern seltener berichtet werden, so dass diese durch das diagnostische Raster fallen.
Wie neuere Studien zur Depression bei Männern zeigen, kann sich diese hinter depressionsuntypischem Verhalten wie gesteigerter Aggressivität, Irritabilität, antisozialem Verhalten oder Sucht- und Risikoverhalten verbergen („männliche Depression“) und deshalb häufig weder rechtzeitig erkannt noch behandelt werden.
Je stärker die Orientierung an traditionellen Maskulinitätsnormen, desto ausgeprägter erscheint diese Abwehrsymptomatik, die offensichtlich die männliche Identität schützen und soziale Diskriminierung als unmännlich und psychisch krank vermeiden soll. Werden solche externalisierenden Symptome zusätzlich zu den prototypischen Symptomen erfasst, reduziert sich der Prävalenzunterschied zwischen den Geschlechtern signifikant.
Die Erweiterung klassischer Depressionskriterien um externalisierende Verhaltensmuster erscheint damit als ein dringend notwendiger Schritt, die Identifizierung von Depression bei Männern zu verbessern und gleichzeitig eine gezieltere Suizidprävention voranzutreiben. Gegenwärtig verfügbare Instrumente zum Depressionsscreening, die psychometrischen Standards genügen, sind rar; derzeit befindet sich ein neues gendersensibles Depressionsscreening der Autorin in der Evaluierungsphase.
Versorgungsdefizite

Trotz ihrer wachsenden gesellschaftlichen, gesundheitsökonomischen und sozialpolitischen Bedeutung sind psychische Störungen insgesamt unterdiagnostiziert und unterbehandelt. Die überwiegende Mehrzahl depressiv Erkrankter wird von Allgemeinmedizinern behandelt, doch nur 30 bis 35 % der depressiv Erkrankten erhalten eine adäquate Diagnose, wobei der Anteil derjenigen, denen eine leitliniengerechte Therapie zukommt, sogar unter 10 % liegt. Männer scheinen hier noch deutlicher benachteiligt zu sein: Fehldiagnosen und inadäquate Behandlungen sind häufiger als bei Frauen.
Studien weisen darauf hin, dass zwischen 35 und 80 % der Betroffenen keine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die Inanspruchnahme ambulanter Psychotherapie beispielsweise liegt je nach Datengrundlage zwischen 1,9 und 3,1 %, wobei die Inanspruchnahme zu zwei Dritteln durch Frauen erfolgt. Auch wenn sich in den letzten Jahren ein Trend zur steigenden Inanspruchnahme bei Männern abzeichnet, bleiben diese doch weiterhin unterrepräsentiert.
Insgesamt muss eine Diskrepanz zwischen der Versorgungslage psychisch kranker Männer und ihrem objektiven Versorgungsbedarf angenommen werden: Während Männer ihre Gesundheit und ihre Lebensqualität im Vergleich zu Frauen subjektiv positiver einschätzen, psychische Probleme eher nicht wahrnehmen oder verleugnen, muss die vorzeitige Sterblichkeit von Männern einschließlich ihrer hohen Suizidrate als Indikator für eine dysfunktionale Stressbewältigung bzw. für einen nicht annähernd gedeckten Behandlungsbedarf interpretiert werden.
Barrieren der Inanspruchnahme
Symptome und
Verhaltensänderungen
BEI „MÄNNLICHER“ DEPRESSION:
♦ Suchtverhalten (Arbeit, Sport, Alkohol, Internet, Sex etc.)
♦ Risikoverhalten
♦ sozialer Rückzug
♦ Abstreiten von Traurigkeit oder psychischen Problemen
♦ rigide Forderungen nach Autonomie
♦ Ablehnung der Hilfe von anderen
♦ zunehmende Häufigkeit von Wutausbrüchen
♦ zunehmende Aggressivität
♦ Feindseligkeit
Die Unterdiagnostizierung und -behandlung von depressiven Männern lässt sich sowohl auf strukturelle Faktoren des Gesundheitssystems als auch auf psychosoziale Barrieren zurückführen. Einige dieser Barrieren sollen im Folgenden kurz skizziert werden.
Strukturelle Defizite des Versorgungssystems
Neben einer unzureichenden Depressionsdiagnostik in der Primärversorgung spielen mangelnde Informationen über psychopharmakologische und psychotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten seitens der Allgemeinmediziner eine Rolle bzw. eine mangelnde Motivation, diese zu nutzen. Außerdem tragen eine regional ungleich verteilte Psychotherapeutendichte und nicht ausreichend vorhandene niederschwellige Angebote zur Unterversorgung bei. Ein wesentlicher Faktor sind darüber hinaus lange Wartezeiten; die durchschnittliche Wartezeit auf ein Erstgespräch dauert drei Monate, die auf einen Therapiebeginn sogar sechs Monate.
Zu den strukturellen Versorgungsdefiziten zählt ebenso eine mangelnde Nachsorge nach stationären Behandlungen depressiv Erkrankter, die zu „Drehtüreffekten“ führt wie eine nicht ausreichende Flexibilisierung von Sprechstunden, die sich an die zeitlichen Möglichkeiten (meist vollzeitberufstätiger) Männer orientiert.
Kommunikationsdefizite in der Arzt-Patienten-Beziehung
Geschlechterstereotype und geschlechterspezifische Kommunikationsstile tragen zu einem Genderbias in der Diagnostik bei. Tendenziell wird bei gleichen Beschwerden bei Frauen eher psychosomatisch, bei Männern eher somatisch diagnostiziert, was zu einer Fehl- bzw. Unterversorgung somatischer Erkrankungen bei Frauen und psychischer Störungen bei Männern führen kann.
Wie in Bezug auf die „männliche“ Depression weiter oben ausgeführt, erschweren nicht nur eine externalisierende Symptomatik des Patienten, sondern auch mangelnde Kompetenz des Arztes in Bezug auf Gendermedizin und gendersensibler Depressionsdiagnostik die adäquate Identifizierung einer Depression. Die Tatsache, dass es Geschlechterunterschiede in der Symptomatik bei ein und derselben Krankheit geben kann ist derzeit noch nicht allgemeinärztliches Standardwissen.
Eine geschlechtersensible Depressionsdiagnostik erfordert, dass männertypische Stresssymptome aktiv und systematisch erfragt werden müssen, was nicht zuletzt auch im Sinne der Suizidprävention positive Konsequenzen hätte.
Dies muss gezielt explorierend geschehen, da Männer dazu neigen, psychische Probleme nicht mitzuteilen, wozu ein maskulin geprägter Kommunikationsstil in der Arzt-Patienten-Kommunikation beitragen kann.
Eine Reihe von Studien belegt, dass der männliche Arzt sich männlichen Patienten gegenüber weniger einfühlsam verhält, mehr redet als der Patient, mehr geschlossene Fragen stellt, den männlichen Patienten mehr unterbricht, autoritärer auftritt und weniger Mitbestimmung zulässt. Dies gilt insbesondere bei männlichen Patienten unterer Sozialschichten. Entsprechend ist der männliche Patient passiver im Gespräch, teilt weniger psychosoziale Informationen (bzgl. Familie, Beruf) mit und spricht weniger über psychische Probleme als er dies bei einem weiblichen Gegenüber tun würde. Das Gespräch zwischen männlichem Arzt und männlichem Patienten weist im Vergleich die kürzeste Dauer auf. Ein partnerschaftlich orientiertes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, Basis für Compliance und Therapieerfolg, verlangt jedoch nicht notwendigerweise mehr Zeit, sondern erfordert die richtigen Fragestellungen und einen männersensiblen Kommunikationsstil.

Traditionelle Maskulinität
Die Abwehr und Stigmatisierung psychischer Probleme wie ihrer Behandlungsformen ist assoziiert mit Normen traditioneller Maskulinität. Zwar sind aufgrund der Frauenemanzipation traditionelle Männlichkeitsbilder ambivalenter, vielfältiger und diffuser geworden, doch sind Formen traditioneller Maskulinität nach wie vor für weite Teile der männlichen Bevölkerung handlungsrelevant und gehören zu den gesellschaftlichen Erwartungen an die männliche Rolle. Normen traditioneller Maskulinität (wie Macht und Dominanz, Kontrolle, Mut, Leistungs- und Wettbewerbsorientierung, Unabhängigkeit, Autonomie, Rationalität, Aktivität und Unverletzlichkeit) bestimmen den Selbstwert und sind nur auf Kosten der Kontrolle „weiblicher“ Emotionen wie Angst, Unsicherheit, Schwäche, Traurigkeit und Hilflosigkeit möglich, wobei eine solche emotionale Kontrolle auf Dauer gesundheitsschädigend sein kann. Die Vorstellung, Probleme autonom und selbstverantwortlich lösen zu müssen, hindert Männer daran, soziale oder professionelle Unterstützung zu suchen und zu nutzen, da das Eingeständnis von Hilfsbedürftigkeit einem Status- und Identitätsverlust gleichkäme.
Soziale Stigmatisierung
Die soziale Stigmatisierung psychischer Störungen muss als einer der wichtigsten Gründe für die geringe Behandlungsquote angesehen werden.
Trotz vielfältiger Bemühungen von Anti-Stigma-Kampagnen in den letzten Jahren konnte die Stigmatisierung psychischer Störungen bisher nicht signifikant und nachhaltig reduziert werden.
Es ist anzunehmen, dass die Angst vor sozialer Stigmatisierung, verstärkt durch ausgeprägte Individualisierung und Leistungsdruck, insbesondere bei Männern zu negativen Einstellungen bezüglich psychischer Störungen führen. So finden sich stereotype, restriktive pessimistische und stigmatisierende Einstellungen gegenüber psychisch Kranken häufiger bei Männern als bei Frauen. Männer sind häufiger als Frauen der Ansicht, dass eine Depression keine Krankheit, sondern Ausdruck einer Charakterschwäche sei, dass man Depression allein bewältigen muss oder dass sie ein normaler Bestandteil des Alterns sei.
Während Psychopharmaka von Männern weitgehend abgelehnt werden, zeigt sich in Bezug auf Psychotherapie eine positivere Grundeinstellung, die im Detail jedoch von Skepsis geprägt und deren Handlungsrelevanz fraglich ist. Männer haben nicht nur stigmatisierendere Einstellungen, im Falle einer eigenen psychischen Erkrankung sind sie auch stärker als Frauen von sozialer Diskriminierung betroffen.
SchlussfolgerungenWährend Gender-Mainstreaming in Politik und Medizin im Wesentlichen auf Frauen und ihre Problemlagen fokussiert, sind Männer gesundheitswissenschaftlich, gesundheits- und sozialpolitisch, aber auch sozialpädagogisch das weitgehend vernachlässigte Geschlecht. In Bezug auf die Depression erscheint eine bessere und frühere Identifikation bei Männern als vorrangiges Ziel. Konsequenzen für die klinische Praxis beinhalten eine männersensitive Depressionsdiagnostik bereits in der Primärversorgung, das Bemühen um eine männersensitive Arzt-Patienten-Kommunikation und um leitliniengerechte Behandlung insbesondere von Männern, was sowohl die Psychopharmaka- als auch die Psychotherapie und ihre Kombination betrifft.
Folgen der Nichtbehandlung von Depression
Wird eine Depression nicht behandelt, kann es zu gravierenden Folgen kommen. Die zunehmende Chronifizierung verursacht nicht nur subjektives Leid und sozialen Abstieg, sondern begünstigt auch eine Fehlversorgung, da nicht psychiatrisch/psychotherapeutisch behandelte psychisch Kranke häufig stationär in somatischen Kliniken behandelt werden, was insbesondere auf Männer zutrifft. Hohe Kosten werden außerdem durch Präsentismus am Arbeitsplatz, häufige und lange Krankschreibungen sowie „Doktorshopping“ verursacht.
Eine der bedeutsamsten, ebenfalls kostenrelevanten Folgen von Unterbehandlung ist ein erhöhtes Risiko für psychische und somatische Komorbidität, insbesondere Alkoholabhängigkeit, kardiovaskuläre Erkrankungen und Diabetes, die ebenfalls kaum erkannt und behandelt werden. Die bisher noch sehr dürftige Datenlage hinsichtlich geschlechterspezifischer Aspekte bei Komorbidität deutet darauf hin, dass bei psychisch kranken Männern im Vergleich zu psychisch kranken Frauen das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen, Schlaganfall oder Diabetes möglicherweise zusätzlich erhöht ist aufgrund einer ausgeprägteren pathogenetischen Wirkung von ungünstigen Lebensstilfaktoren. Konsistente Befunde aus der internationalen Forschung verweisen auf eine drastisch verkürzte Lebenserwartung bei psychisch Kranken (20 Jahre bei Männern, 15 Jahre bei Frauen), die nicht nur auf die hohe Suizid- und Komorbiditätsrate, sondern auch auf eine – im Vergleich zu chronisch Kranken ohne psychische Störung – wesentlich schlechtere medizinische Versorgung zurückgeführt werden muss.
Literatur bei der Autorin
Buchtipp
Vom Dauerstress zur Depression: Wie Männer mit psychischen Belastungen umgehen und sie besser bewältigen können
Im Beruf und Alltag jederzeit funktionieren, sich abschotten, wenn es einmal nicht so gut läuft, die Fassade wahren – so die Devise vieler Männer. Doch ist der Stress in der Arbeit zu stark oder die Beziehung in der Krise, kann schon einmal alles zu viel werden. Was dann folgt ist Depression: Gerade vom starken Geschlecht wird sie oftmals tabuisiert und unterschätzt.
Warum sind Männer verletzlicher als allgemein angenommen? Die Autorin beschreibt vor dem Hintergrund der aktuellen Depressions- und Männerforschung die vielfach verdeckten Erscheinungsformen männlicher Depression, ihre Ursachen und die typischen Bewältigungsstrategien. Sie plädiert für einen offeneren Umgang mit der Krankheit und zeigt Wege der Prävention und Behandlung auf.
Anna Maria Möller-Leimkühler, Vom Dauerstress zur Depression: Wie Männer mit psychischen Belastungen umgehen und sie besser bewältigen können, 279 Seiten,
22,99 Euro, ISBN-13: 978-3903072336, Fischer & Gann