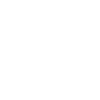Die Dokumentationspflicht des Arztes
Häufig berichten niedergelassene Ärzte, dass sie sich von der als stetig zunehmend empfundenen Dokumentationspflicht immer mehr belastet fühlen und häufig das Gefühl haben, dass vor „lauter Dokumentation die eigentliche Arbeit als Mediziner zu kurz kommt“. Doch an der Verpflichtung, die Behandlung zu dokumentieren, führt kein Weg vorbei.

Die Verpflichtung des Behandelnden zur Dokumentation ergibt sich aus § 630 f BGB und stellt eine sogenannte Nebenpflicht aus dem Behandlungsvertrag dar. Darüber hinaus ergibt sich die Dokumentationspflicht aber auch aus dem Bundesmantelvertrag Ärzte und den jeweiligen Berufsordnungen. Sie dient in erster Linie der sachgerechten therapeutischen Behandlung und Weiterbehandlung und soll wiederholende Untersuchungen einschließlich der dadurch ausgelösten Belastungen und Kosten vermeiden. Zweck der Dokumentation ist aber ebenso die Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Patienten, der Anspruch auf Rechenschaft über die Behandlung hat, die er in der Regel als medizinischer Laie nicht beurteilen kann.
Wenngleich die faktische Beweissicherung durch die Dokumentation erfolgt, soll die Sicherung von Beweisen für einen späteren Haftungsprozess des Patienten nicht (Haupt-)Zweck der Dokumentationspflicht sein. Neben der Beweissicherung ist die Dokumentation in der vertragsärztlichen Versorgung aber auch für Abrechnungsfragen von Bedeutung. So ist bei verschiedenen Leistungspositionen im EBM die Dokumentation explizite Abrechnungsvoraussetzung. Da die Prüfung der Abrechnung von Vertragsärzten gesetzlich vorgeschrieben ist, wird im Rahmen von Wirtschaftlichkeits- oder Plausibilitätsprüfungen die Dokumentation regelmäßig angefordert und geprüft.
Auf einen BlickGesetzliche Grundlagen: § 630 f BGB, Bundesmantelvertrag Ärzte (BMV-Ä) sowie die jeweiligen Berufsordnungen
Zweck: Beweissicherung in möglichen gerichtlichen Auseinandersetzungen und Dokumentation der Abrechnung vertragsärztlicher Leistungen
Umfang: Die Nachvollziehbarkeit der medizinischen Behandlung muss stets aus fachlicher Sicht gewährleistet sein
Verantwortlichkeit: Die Dokumentationspflicht betrifft den behandelnden Arzt, sie kann ggf. aber auch delegiert werden
Zeitpunkt: Die Dokumentation muss „in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung“ erfolgen oder ggf. unmittelbar nach Abschluss der Behandlung
Nachträge mit Datum und Grund für den Nachtrag sind zulässig
Formanforderung: in Papierform oder elektronisch. Änderungen der Dokumentation müssen immer nachvollziehbar bleiben
Bei der Dokumentation auf elektronischem Wege gilt:
- eine fälschungssichere Software muss verwendet werden
- Daten dürfen nicht an unbefugte Dritte weitergegeben werden
- bei externen EDV-Dienstleistern Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen lassen
Im Streitfalle: Die Patientenakte dient in gerichtlichen Auseinandersetzungen in der Regel als wichtigstes Beweismittel
Umfang der Dokumentation
Im Gesetz heißt es zum notwendigen Umfang der Dokumentation: „Der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnosen, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzunehmen.“
Die Aufzählung im Gesetz ist nicht abschließend. Für die Darstellung reichen Abkürzungen, Stichworte und Zeichen aus, die für den Fachmann verständlich sind, Laienverständlichkeit ist also nicht gefordert. Die Dokumentation der für die Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse ist rechtlich jedoch nur geboten, soweit sie aus medizinischer, sprich fachlicher Sicht des Behandelnden, erforderlich ist, medizinische Selbstverständlichkeiten sind danach nicht dokumentationspflichtig. Routinemaßnahmen wie beispielsweise die Desinfektion der Haut vor einer Injektion oder das Tragen von Handschuhen bei einem operativen Eingriff sind danach nicht dokumentationspflichtig. Entscheidend ist letztlich die Gewährleistung der Nachvollziehbarkeit der Behandlung aus fachlicher Sicht. Was im konkreten Fall zu dokumentieren ist, kann im Einzelfall aber sehr schwierig sein und unterliegt im Streitfall einer sachverständigen Beurteilung.
Zeitpunkt der Dokumentation
Dokumentationspflichtig ist der die jeweilige Behandlung durchführende Arzt, wobei die Dokumentationspflicht grundsätzlich auch delegiert werden kann. Pauschale Fristen innerhalb derer die Dokumentation erfolgen muss, gibt es nicht. Die Dokumentation muss aber „in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Behandlung“ erfolgen. Ist die Dokumentation während der Behandlung nicht möglich, soll sie unmittelbar nach Abschluss der Behandlung nachgeholt werden. Insbesondere in den typischen Weiterbehandlungsfällen (Einweisung, Überweisung) ist auf die Rechtzeitigkeit der Dokumentation und deren Übermittlung zu achten, sodass die Fortsetzung der Behandlung gewährleistet ist.
Nachträge sind zulässig
Gleichwohl ist es zulässig, Nachträge hinzuzufügen. Dieser Nachtrag muss mit Datum und Grund für den Nachtrag versehen werden. Dies hängt wiederum damit zusammen, dass der Zeitpunkt der Dokumentation ein wesentlicher Faktor für die Richtigkeit der dokumentierten Maßnahme sein kann. Denn je später eine Maßnahme dokumentiert wird, umso mehr spricht in der Regel dafür, dass die Dokumentation nur noch aus dem Gedächtnis erfolgte.
Form der Dokumentation
Die Dokumentation kann in Papierform oder elektronisch erfolgen. Insbesondere für die elektronische Patientenakte (ePA) gilt es dabei sicherzustellen, dass Berichtigungen und Änderungen der Dokumentation nachvollziehbar bleiben, da diese nur zulässig sind, wenn der ursprüngliche Inhalt auch erkennbar bleibt. Ebenso muss erkennbar sein, wann die Vornahme der Änderung erfolgt ist. Für die ePA ist also ausschließlich eine fälschungssichere Software zu verwenden. Zudem darf genauso wenig wie auf die Patientenakte in Papierform, auf die ePA von unbefugten Dritten zugegriffen werden. Sollte also ein externer Dienstleister das Praxis-EDV-System warten, ist hieran zu denken und von diesem eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterzeichnen zu lassen.
Ersetzendes Scannen
Führt eine Praxis nur noch eine elektronische Patientenkartei, erhält aber zum Beispiel von mit- oder weiterbehandelnden Kollegen Arztbriefe oder Befundberichte in Papierform, können diese eingescannt und anstelle des Originals elektronisch aufbewahrt werden, das sogenannte ersetzende Scannen. Zu beachten ist dabei aber, dass dem eingescannten Dokument nicht derselbe Beweiswert zukommt, wie dem als Urkunde zu qualifizierenden Original. Daher sollte man im Einzelfall abwägen, ob das Original in Papierform nach dem Scannen vernichtet oder doch aufbewahrt wird.
Folgen einer Verletzung der Dokumentationspflicht
Die Folgen einer solchen Pflichtverletzung können schwerwiegend sein. Die Verletzung der ärztlichen Dokumentationspflicht ist überwiegend Gegenstand von sogenannten Beweislastfragen im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung, gleichwohl ist die Pflicht zur Dokumentation auch eine berufsrechtlich normierte Pflicht (s. o.) und kann – wenn auch in seltenen Fällen – berufsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
KV-Abrechnung
Gehört die Dokumentation explizit zum obligaten Leistungsinhalt einer Gebührenordnungsposition im EBM und kann diese Dokumentation nicht beigebracht werden (ebenfalls s.o.), so kann es ferner im Rahmen von sachlich-rechnerischen Berichtungen und Plausibilitätsprüfungen zur Streichung dieser Leistungen kommen, was teils hohe Rückforderungssummen nach sich ziehen kann.
Behandlungsfehler
Kommt es einmal zum Vorwurf des Behandlungsfehlers, für den der Patient grundsätzlich beweisbelastet ist, so ist die Patientenakte in aller Regel das wichtigste Mittel der Verteidigung. Einen Automatismus zwischen mangelhafter Dokumentation und Schadensersatz gibt es nicht, gleichwohl führt eine lückenhafte Dokumentation zu Beweiserleichterungen für den Patienten.
In § 630 h Abs. 3 BGB heißt es wie folgt: „Hat der Behandelnde eine medizinisch gebotene wesentliche Maßnahme und ihr Ergebnis entgegen § 630 f Absatz 1 oder Absatz 2 nicht in der Patientenakte aufgezeichnet oder hat er die Patientenakte entgegen § 630 f Abs. 3 nicht aufbewahrt, wird vermutet, dass er diese Maßnahme nicht getroffen hat“.
Diese Vermutung erstreckt sich insoweit auf unterbliebene, lückenhafte, nicht zeitnahe und auch nicht auffindbare oder nicht mehr vorhandene Dokumentationen, wobei die Vermutung nur greift, solange die Dokumentationspflicht zeitlich auch – noch – besteht, sodass diese nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen nicht mehr auf eine lückenhafte oder nicht mehr vorhandene Dokumentation anwendbar ist. Auch ist diese Regelung des § 630 h Abs. 3 BGB nicht anwendbar auf Pflichtverletzungen in Bezug auf die Dokumentation von Aufklärung und Einwilligung des Patienten, da er allein für medizinische Maßnahmen und deren Ergebnisse gilt.
Patient in der Beweispflicht
Die gesetzliche Vermutung erstreckt sich grundsätzlich zudem auch nicht auf die Kausalität zwischen der nicht dokumentierten Maßnahme und dem – behaupteten – Schaden, will heißen: der Patient bleibt in der Beweispflicht für den Ursachenzusammenhang zwischen dem mutmaßlichen Arztfehler und den späteren Beschwerden/dem Schaden; anders wäre dies nur bei einem sogenannten groben Behandlungsfehler.
Zeitliche Distanz erschwert Aufklärung
Selbstverständlich kann der Behandelnde die Vermutung durch den Beweis des Gegenteils widerlegen. Es ist jedoch häufig schwierig, Dokumentationslücken im Streitfall durch die Befragung des Behandlers oder des nichtärztlichen Personals zu schließen, was nicht zuletzt darin begründet ist, dass häufig viel Zeit vergeht zwischen dem Zeitpunkt des vom Patienten behaupteten Behandlungsfehlers und der gerichtlichen Klärung desselben.
Fazit
Aufgrund der möglichen, weitreichenden Folgen bei der Nichtbeachtung der Dokumentationspflicht sollte diese von allen an der Behandlung eines Patienten Beteiligten ernst genommen werden – in erster Linie zum Wohle des Patienten, ganz sicher aber auch im eigenen Interesse.