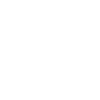Psychopharmaka – Fakten und Mythen
Die Psychiatrie ist ein Teilgebiet der Medizin, überschreitet dieses aber bei Weitem. Kein zweites Fach- bzw. Teilgebiet der Medizin ist so eng mit gesellschaftspolitischen Vorstellungen und Strömungen des Zeitgeistes verwoben. Seit wann gibt es Psychopharmaka und wie ist ihre geschichtliche Entwicklung?
6 Fragen und Antworten zu Psychopharmaka
|

Psychopharmaka - Eine Entdeckungsgeschichte
Psychische Erkrankungen sind so alt wie die Menschheit selbst. Und von Anfang an haben die, die helfen wollten, sich nicht nur religiöser Rituale, Gebete oder aufbauender Gespräche bedient, sondern ebenso versucht, durch chemische Substanzen den Geist zu beeinflussen. Die meisten dieser Substanzen werden heute als Drogen gehandelt. Ein Beispiel ist Kokain: Es war in der religiösen Kultur der indigenen Bevölkerung Südamerikas tief verwurzelt, es ließ Sorgen vergessen und vertrieb Müdigkeit und Hunger. Die ersten Psychopharmaka, die nach wissenschaftlichen Kriterien entwickelt wurden, lösten Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts fast eine Revolution in der Psychiatrie aus. Allmählich setzte sich von da an die Erkenntnis durch, dass psychische Erkrankungen mit der Biologie des Gehirns und der Genetik ebenso viel zu tun haben wie mit frühkindlichen Erfahrungen und psychosozialem Stress.
Gesellschaftlicher Zeitgeist
Der Einsatz von Psychopharmaka ist eng mit den Strömungen des jeweiligen gesellschaftlichen Zeitgeistes verbunden. Dies wirkt sich auch auf die unterschiedlichen Therapieformen aus. Bis in die 50er-Jahre des letzten Jahrhunderts hinein waren es noch tiefenpsychologische Therapien oder Psychoanalyse, die nahezu für den Goldstandard gehalten wurden. Bis weit in die 1980er-Jahre war es unter Psychotherapeuten nahezu verpönt, Psychopharmaka bei ihren Patienten überhaupt einzusetzen. Der Erfolg dieser Substanzen im weiteren Verlauf hat aber dazu geführt, dass heute bei den meisten psychischen Erkrankungen eine Kombination aus einer psychopharmakologischen und einer verhaltens- bzw. gesprächstherapeutischen Behandlung angewendet wird.
Zur Erfolgsgeschichte zählt die Einführung der atypischen Neuroleptika in den 1990er-Jahren, die bei nahezu gleicher Wirkung eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, als unangenehme Nebenwirkung Parkinson-ähnliche Symptome hervorzurufen, wie es häufig bei den älteren Neuroleptika der Fall ist. Ebenso zählt die Entwicklung potenter Anxiolytika, wie beispielsweise Pregabalin, die größtenteils kein Abhängigkeitspotential haben, dazu.
Zu beobachten ist zugleich, dass manche Psychopharmaka gezielt dazu eingesetzt werden, jenseits von psychischen Erkrankungen kognitive Leistungen und Konzentration zu verbessern. Der Begriff „Hirndoping“ bringt dies auf den Punkt. Schon im Jahr 2000 bemerkte hierzu ein US-amerikanischer Arzt ohne Ironie: „Die Leistungen im Studium hängen von der Qualität bestimmter Apotheken am Ort ab.“ Die Bewertung menschlichen Verhaltens und dessen Klassifikation als psychische Erkrankung sollte deswegen immer im jeweiligen historischen Kontext gesehen werden.

Das Buch
Im Laufe meiner 30-jährigen klinischen Tätigkeit ist mir in Gesprächen mit meinen Patienten aufgefallen, dass einige Aspekte in der Therapie mit Psychopharmaka kaum bekannt sind. Wie beispielsweise die Gleichgültigkeit, die von Antidepressiva aus der Gruppe der Serotoninwiederaufnahmehemmer ausgelöst wird. Diese Gleichgültigkeit nutzen einige gezielt, um in der widrigen Arbeitswelt zurechtzukommen. Zudem stellten die Patienten mir oft ähnliche Fragen: Ändern Psychopharmaka die Persönlichkeit? Machen Antidepressiva dick? Oder machen Antidepressiva abhängig?
Solche Aspekte und Fragen in Verbindung mit interessanten Anekdoten (Wer beispielsweise weiß schon, dass Marilyn Monroe mit einem Stich in die Kapsel für eine schnellere Wirkung des süchtig machenden Medikaments sorgte?) bildeten die Grundlage für die Idee des Buchs „Psychopharmaka und Drogen – Fakten und Mythen in Frage und Antwort“. Über 100 Fragen und Antworten erläutern Wirkungsweisen und historische Entwicklungen von psychoaktiven Substanzen, worin der Erfolg der Psychopharmaka begründet ist, aber auch welche Risiken und Abwege damit verbunden sind. Das Buch ist eine Entdeckungsgeschichte der Psychopharmaka mit sozialpsychologischer Grundierung, der auch die regelmäßig eingeflochtenen historischen Anekdoten dienen. Es richtet sich nicht nur an Ärzte und Studenten, sondern auch an interessierte Laien und Patienten, die sich über Psychopharmaka und Drogen grundsätzlich informieren möchten.