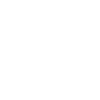Klassische Haftungsfallen in der gynäkologischen Praxis – typische Aspekte
Nachdem in einem ersten Beitrag im Wirtschaftsmagazin für den Frauenarzt Ausgabe 5/2019 klassische Fragen besprochen wurden, die forensisch häufig in der Gynäkologie auftreten können, sollen nun weitere Aspekte beleuchtet werden, die mitunter im gynäkologischen Alltag haftungsträchtig sind. Man kann ihnen aber mit einer ordnungsgemäßen Dokumentation vorbeugen.
![LuckyVector_shutterstock_1069365725_[Konvertiert]](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_LuckyVector_shutterstock_1069365725__Konvertiert__c37029c6d2.png)
Anfällig ist stets der Bereich ordnungsgemäßer Anamneseerhebung. Sie ist die Basis für jede fachärztlichem Standard entsprechende Behandlung und wird natürlich in der Ausbildung erlernt. Hierzu sind auch forensisch ein paar Punkte zu beachten. Denn fast jeder dürfte z. B. schon erlebt haben, dass bei Auftreten einer Erkrankung plötzlich doch einschlägige familiäre Vorerkrankungen genannt werden, die zuvor nicht berichtet wurden, für die Planung einer vorsorgenden Betreuung aber relevant gewesen wären. Manche Patientinnen haben aber diese relevanten Angaben am Tag der Anamnese vergessen oder erfahren selbst erst von ähnlichen Fällen in der Familie, wenn sie ihre Erkrankung dort berichten. Anderen wurden Informationen familiär vorenthalten oder sie wissen einfach nicht, was im Stammbaum relevant gewesen wäre.
Dies muss daher gemeinsam erarbeitet werden und erfordert zudem fortlaufend eine Anamnese. All dies ist sorgfältig zu dokumentieren, was auch den Zeitpunkt einschließt, zu dem man Mitteilungen erhält. Die heutige EDV hilft einem dabei. Teils werden Anamnesen aber immer noch auf Außenseiten von Karteikarten vermerkt, in denen Arztbriefe und ähnliche externe Befunde abgelegt werden. Schreibt man hier undifferenziert ohne zeitliche Kennung eine erst spätere Information zu anfänglich spärlicheren Daten, kann es schwer werden, auf eine anderweitig nachträgliche Behauptung hin zu widerlegen, dass eine Information anfangs noch nicht vorlag.
Verlass auf Patientenangaben
Aber auch wenn man Angaben von Patientinnen erhält, darf man sich auf sie je nach Situation nicht vorschnell verlassen. Als typisches Beispiel dient etwa die Angabe eines bereits negativen Schwangerschaftstests. Denn trotzdem sollte man diese Information je nach Vorstellungsgrund durch eigene Befunderhebungen nochmals objektivieren.
Kommt nämlich eine junge Patientin mit (Zwischen-)Blutungen und/oder Beschwerden in die Sprechstunde und lässt man eine mögliche Schwangerschaft vorschnell außer Acht, kann dies kritisch werden. Die zur Eigenanwendung zugänglichen Tests geben nämlich keine 100%ige Sicherheit und können falsch oder zum falschen Zeitpunkt angewendet worden sein. Ohnehin wäre differenzialdiagnostisch eine Extrauteringravidität (EUG) zu bedenken, gerade wenn der Ultraschall keine intrauterine Fruchtanlage zeigte. Dies führt wiederum zu weiter gebotenen Untersuchungen wie einem Blutschwangerschaftstest mittels Messung des ß-HCGs; und zwar auch im Verlauf der Werte.
Auch hier gilt: alles sorgfältig einschließlich eigener Überlegungen und Erörterungen mit der Patientin dokumentieren.
Nur ordnungsgemäße Dokumentation hat Beweiswert
Man sollte sich auch über die Zeitkomponente haftungsrechtlicher Streitigkeiten im Klaren sein, die bis zu Jahren reicht. Derart spät aber erst Widersprüche oder Ungereimtheiten durch eigene Erinnerung noch schließen zu wollen, ist schwer und für Gerichte in Anbetracht der Masse an Patientinnen, die täglich behandelt werden, selten glaubhaft.
Aus dem Grund empfiehlt es sich auch, sofort nach Erhalt des Forderungsschreibens einer Patientin ein Gedächtnisprotokoll über deren Behandlung mit allen Einzelheiten zu verfassen, die einem über die Dokumentation hinaus noch einfallen. Dieses Dokument zählt nicht zur Behandlungsdokumentation, sollte also getrennt verwahrt und nur der eigenen Versicherung und dem eigenen Anwalt zur Verfügung gestellt werden.
Dies wäre auch das richtige Mittel, um Lücken oder Fehler in der Dokumentation zu schließen bzw. zu korrigieren, die einem zumeist erst auffallen, wenn es zu spät ist, nämlich wenn eine Patientin schon Einsicht in ihre Unterlagen verlangt. Hier darf stattdessen auf keinen Fall mehr ohne ausdrückliche Kenntlichmachung im Nachhinein eine Änderung der Unterlagen erfolgen. Denn nur die ordnungsgemäß geführte Dokumentation hat (urkundlichen) Beweiswert, sodass Gerichte und Sachverständige dann vom so festgehaltenen Verlauf ausgehen müssen.
Auf einen BlickNur eine ordnungsgemäße Dokumentation hat Beweiswert.
Dokumentieren Sie Informationen, die Ihnen erst zu einem späteren Zeitpunkt vorliegen, differenziert mit zeitlicher Kennung.
Je nach Vorstellungsgrund der Patientin objektivieren Sie die Patientenangaben nochmals durch eigene Befunderhebungen.
Bei Erhalt eines Forderungsschreibens einer Patientin, fertigen Sie ein Gedächtnisprotokoll über alle Einzelheiten der Behandlung an, die Ihnen über die Dokumentation hinaus einfallen. Dieses Dokument zählt nicht zur Behandlungsdokumentation. Verwahren Sie es getrennt und händigen Sie es ggf. nur der eigenen Versicherung und dem eigenen Anwalt aus.
Kennzeichnen Sie nachträgliche Änderungen ausdrücklich.
Verlangt eine Patientin die Herausgabe ihrer Behandlungsunterlagen, fertigen Sie eine vollständige Kopie der gesamten Dokumentation an.
Nehmen Sie stets eine ausreichende Sicherungsaufklärung vor.
Legen Sie ein festes Kontrollintervall zur Abklärung von Beschwerden fest.
Vorsicht bei nachträglichen Änderungen
Ändert man hingegen etwas nachträglich, wird die Richtigkeit der Dokumentation bestreitbar, womit tatsächlich der Beweiswert verloren gehen kann und zwar losgelöst davon, ob die fragliche Ergänzung/Korrektur richtig war oder nicht. Ohne Kenntlichmachung einer nachträglichen Änderung ließe sich sogar darüber streiten, ob eine Urkundenfälschung oder ein (versuchter) Prozessbetrug vorliegt, sobald in letzterem Fall solche Unterlagen kommentarlos in einem Prozess vorgelegt würden. Die Gerichte sind für diese Fragen äußerst sensibilisiert und nicht wenige Zivilprozesse ziehen inzwischen auch strafrechtliche Ermittlungen nach sich.
Einsicht in Behandlungsunterlagen
Ähnliche Fehler kann man beim Verlangen auf Herausgabe der Behandlungsunterlagen begehen, indem verspätet, lückenhaft oder nach und nach erst Kopien bereitgestellt werden. Denn es muss von Anfang an eine vollständige Kopie der gesamten Dokumentation gefertigt werden, sobald und soweit dies verlangt wird. Zum Umfang der herauszugebenden Unterlagen zählt vereinfacht alles, wo der Name der Patientin draufsteht und ihr zugeordnet werden kann; also nicht etwa nur ein EDV-Ausdruck ihrer Diagnosen.
Abgesehen davon, dass man bei Vorlage lückenhafter Unterlagen eine Herausgabeklage provoziert, gegen die man sich kaum erfolgreich wehren kann und für die im Übrigen auch die Berufshaftpflichtversicherungen keinen Deckungsschutz gewähren, ist sonst vor Gericht auch der Streitpunkt beliebt, ob und inwieweit ein später im Prozess vorgelegter, umfassenderer Ausdruck einer Karteikarte vielleicht sogar unverwertbar sein könnte. Auch wenn der Arzt wirklich dachte, nicht alles zur Verfügung stellen zu müssen oder es vergessen hat bzw. Personal überließ, das erst recht nicht so richtig wusste, was kopiert werden muss, hilft nicht.
Der Anwalt der Patientin wird und muss dann sogar in den Raum stellen, dass der Dokumentation kein Glauben mehr zu schenken ist. Dies kann ein erster wichtiger Punktsieg sein. Zumal es leider heute noch (veraltete) Praxissoftware gibt, die nicht die Anforderungen der Rechtslage erfüllt, gegen nicht erkennbare, nachträgliche Veränderungen programmierungsseitig gesichert zu sein.
Unspezifische Hinweise gelten nicht vor Gericht
Als Haftungsrisiko erweist sich in der Praxis leider oft auch die Steuerung von Patientinnen. So ist zwar grundsätzlich anerkannt, dass sie an Heilungsbemühungen mitzuwirken haben und ärztlichen Therapie- und Kontrollanweisungen nachkommen müssen. Mit Rücksicht auf den Wissens- und Informationsvorsprung eines Arztes gegenüber medizinischen Laien ist allerdings in der Rechtsprechung sowohl bei der Bejahung denkbaren Mitverschuldens von Patienten an der Entstehung von Gesundheitsschäden, als auch bei der Einforderung von konkreten Mitwirkungspflichten eine deutliche Zurückhaltung zu spüren. Denn der Arzt muss Patienten auch im Rahmen der sogenannten therapeutischen Sicherungsaufklärungspflicht erst einmal in die Lage versetzen, solchen Pflichten nachkommen zu können, also z.B. zu verstehen, wann und warum eine Wiedervorstellung (WV) geboten ist. Dem meinen viele schon mit der Empfehlung „WV, falls Beschwerden anhalten“ nachgekommen zu sein. Gerichte lassen solche unspezifischen Hinweise aber oft nicht ausreichen, da schon unklar bleibt, bis wann und in welcher Intensität etwaige Beschwerden noch andauern dürfen. Besser ist folglich auch hier mit der Patientin im Vorhinein ein festes Kontrollintervall festzulegen.

Unterlagen, die Sie bei Verlangen auf Einsicht herausgeben müssen: |
|